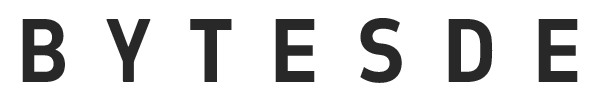Das Anzweifeln und die kritische Auseinandersetzung sind das Wesen der Wissenschaft – und je mehr das gefördert wird, desto erfolgreicher und weniger anfällig für Fehler ist die Forschung
Daniela Berg
Nach Ansicht der Expertin könnten aber verschiedene Maßnahmen dieses Risiko maßgeblich verringern. Wesentliche Kriterien für die „Sicherheit“ von Forschungsergebnissen sind die Replizierbarkeit und die Reproduzierbarkeit. „Ersteres bedeutet, dass ein Experiment, das unter genau den gleichen oder leicht abgewandelten Bedingungen durchgeführt wird, zu den gleichen Ergebnissen kommt und damit ihre Generalisierbarkeit bestätigt. Der Begriff Reproduzierbarkeit wird häufig allgemeiner verwendet und bedeutet in der Regel, dass die Ergebnisse wiederholt generiert werden können – auch von anderen Forschungsgruppen bzw. Laboren“, erklärt die Expertin. Die Reproduktion durch eine andere Forschungsgruppe ist oft nicht unmittelbar festzustellen, da unpublizierte Daten und Forschungsansätze zunächst nicht mit anderen, konkurrierenden Arbeitsgruppen geteilt werden. Die Replizierbarkeit im eigenen Haus wird damit zu einem wesentlichen Qualitätskriterium.
Entsprechend wichtig sei es, in einer Arbeitsgruppe eine Kultur des Hinterfragens und eine gute Fehlerkultur zu etablieren. „Das Anzweifeln und die kritische Auseinandersetzung sind das Wesen der Wissenschaft – und je mehr das gefördert wird, desto erfolgreicher und weniger anfällig für Fehler ist die Forschung“, so Prof. Berg. Sie plädiert daher für flache Hierarchien in der Wissenschaft, in der eine offene Fehlerkultur auch die Leitenden der Forschungsgruppen einschließt – so, wie es in Deutschland und Europa bereits vielerorts Standard ist. Denn bei Forschungsskandalen, auch bei dem aktuellen, seien es oft hochrenommierte Persönlichkeiten, die unter den Verdacht von Manipulation und Täuschung geraten. In einer hierarchischen, autoritären, vielleicht sogar angstbesetzten Arbeitsstruktur trauen sich Mitarbeitenden nicht, den Chef auf Fehler hinzuweisen. „Die Leitungsebenen haben daher eine besondere Verantwortung, ein gutes Klima der Offenheit und des Vertrauens zu schaffen“, mahnt Berg. Kritische Mitarbeitende seien gute Mitarbeitende. Das sieht auch die DFG so: „So erfüllen Hinweisgebende, die einen begründeten Verdacht eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens anzeigen, eine für die Selbstkontrolle der Wissenschaft unverzichtbare Funktion. Wissenschaftliche Fachgesellschaften fördern gute wissenschaftliche Praxis durch eine gemeinsame Willensbildung ihrer Mitglieder und durch die Festlegung forschungsethischer Standards, auf die sie ihre Mitglieder verpflichten und die sie in der Community etablieren.“2
Auch bedürfe es eines konstruktiven Umgangs mit Fehlern. „Fehlschläge, Ablehnungen und Scheitern gehören im Kern zur Wissenschaft und negative Forschungsergebnisse tragen ebenso wie positive zum Erkenntnisgewinn bei“, so die Parkinson-Forscherin. Wie sie glaubt, bedarf es eines Umfelds, das Scheitern zulässt, negative Ergebnisse bekannt und somit „salonfähig“ macht. Der Titel eines juristischen Workshops der Uni Hannover brachte das mit dem Begriff des „Nach-vorne-Scheiterns“ gut auf den Punkt. Noch sei aber häufig der Druck, positive Ergebnisse zu generieren, die treibende Kraft, was man daran ablesen könne, dass positive Studien meist als hochwertiger eingestuft würden und am Ende oft auch hochrangiger publiziert werden könnten. „Ein solches Umfeld kann ein unbewusstes Bias darstellen, negative Signale werden von den Forschenden dann leichter übersehen.“