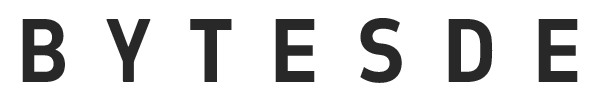Der Hass auf die USA verbindet politische Lager, die sonst wenig gemeinsam haben. Das ist keine neue Erscheinung: Eine Geschichte des Antiamerikanismus.

Universal Images Group / Getty

akg
Im Herbst 1787 landete eine eigenartige Fracht in Le Havre. Mit einem Schiff aus Portsmouth, USA, kam ein Kiste an, die das Fell, die Knochen und das Geweih eines zwei Meter grossen Elchs enthielt. Adressat der Sendung war Georges-Louis Leclerc de Buffon, einer der damals bekanntesten Naturforscher. Als Absender firmierte Thomas Jefferson.
Der Mann, der die amerikanische Unabhängigkeitserklärung mitverfasst hatte und ab 1801 als dritter US-Präsident amtieren sollte, hatte 1787 viel Zeit darauf verwendet, den Tiertransport zu organisieren. Politisch, da war sich Jefferson sicher, war dieses Projekt für sein Land von grosser Bedeutung. Der Elch sollte nämlich das schlechte Image aufbessern, das die USA in Frankreich hatten.
Die junge amerikanische Republik hatte im Europa der Aufklärungszeit zwar viele Freunde. Doch eine der damals wichtigsten Wissenschaften, die Naturgeschichte, zeichnete ein düsteres Bild der «neuen Welt»: Aufgrund klimatischer Bedingungen sei Amerika nicht zum Leben geeignet. Die Natur, erklärten Buffon und andere Gelehrte, könne sich dort nicht richtig entwickeln. Alle Arten, die sich in Amerika fänden, seien kleiner als jene, die in Europa vorkämen. Nutztiere, die man nach Amerika bringe, würden in der neuen Umgebung schrumpfen, und auch die Menschen vegetierten jenseits des Atlantiks eher vor sich hin, als dass sie wirklich lebten: «Keinerlei Lebhaftigkeit, keinerlei seelische Aktivität», hielt Buffon fest.
Seine Theorie der «Degeneration» zirkulierte in den Salons der bürgerlichen Eliten und beeinflusste deren Amerikabild. Jefferson, der in den 1780er Jahren als Botschafter in Paris weilte und Handelsverträge abschliessen wollte, befürchtete das Schlimmste: Mit einem dahinserbelnden Land, so seine Sorge, würde sich niemand auf Geschäfte einlassen. Also ging er daran, Buffon zu widerlegen. Er sammelte Daten zu allen möglichen Tieren und publizierte Tabellen, die belegten, dass amerikanische Bären, Biber oder Kühe schwerer und grösser waren als ihre europäischen Verwandten. Und weil er sicher sein wollte, dass seine Botschaft ankam, liess er den Zahlen Knochen folgen: Das Skelett des riesigen Elchs sollte Buffon und die Franzosen endgültig von der Stärke Amerikas überzeugen.
Buffon starb kurz nach Ankunft des Elchs, seine Theorie konnte er nicht mehr revidieren. Aus den Naturwissenschaften ist die Degenerationsthese mit der Zeit dann zwar trotzdem verschwunden – den abwertenden Blick auf Amerika aber haben die Europäer seit Buffons Tagen nie mehr verloren. Der Zoologe schrieb gewissermassen das erste Kapitel einer langen Geschichte: jener des antiamerikanischen Denkens.
Am Anfang stehen die Reaktionäre
Antiamerikanismus scheint heute überall zu sein. In Putins Russland ist der Hass auf die USA quasi Staatsräson, in islamistischen Kreisen verkörpert Amerika das radikal Böse, und in Westeuropa staunt man darüber, dass sich die beiden Pole des politischen Spektrums in der Amerikaverachtung treffen: Vertreter der äussersten Linken haben für die «imperialistischen» USA genauso wenig übrig wie Rechtsnationale, die die amerikanische «Gleichmacherei» verdammen.
Gerade die Verbindung eigentlich gegensätzlicher Lager zeichnet den Antiamerikanismus indessen seit langem aus: Schon im 19. Jahrhundert schimpften sowohl Konservative als auch Progressive auf die Vereinigten Staaten. Dabei störten sie sich meist nicht an einzelnen politischen Entscheiden, die die Amerikaner trafen. Vielmehr lehnten sie sich gegen all das auf, was die USA in ihren Augen repräsentierten. Man sollte den Antiamerikanismus daher, wie der Historiker Dan Diner schreibt, als «Mentalität» begreifen.
In dieser Mentalität, man könnte auch von einer Weltanschauung sprechen, spielte Buffons Idee der Degeneration weiterhin eine zentrale Rolle. Nur dass man den Niedergang im 19. und 20. Jahrhundert nicht mehr in der amerikanischen Natur ausmachte, sondern in der angeblich negativen Entwicklung des Staates, des Geists oder der Kultur.
Die Ersten, die sich in dieser Weise gegen Amerika wandten, waren die Reaktionäre, die die Französische Revolution bekämpften. Deren Ausbruch führten manche direkt auf den Einfluss Amerikas zurück: Die dortigen Revolutionäre wollten nun auch «die allgemeine Ruhe von Europa» stören, wusste ein deutsches Journal zu berichten. Die zuerst in Amerika proklamierte Idee, dass alle Menschen gleiche Rechte haben, war ein Greuel für alle Aristokraten, die an der hierarchischen Ordnung der Stände festhielten. Für sie waren Staaten und Institutionen nur dann legitim, wenn sie historisch gewachsen waren und auf alten Traditionen ruhten. Dass Menschen wie in Amerika von einem Tag auf den anderen eine neue Nation ins Leben riefen, empfanden sie als anmassend und töricht.
Im frühen 19. Jahrhundert machten konservative Autoren diese angebliche Geschichtslosigkeit der Vereinigten Staaten zum Kernpunkt giftiger Tiraden. Besonders die romantischen Dichter, schreibt der Historiker Jesper Gulddal, hätten dabei eine Art «Basisvokabular» des Antiamerikanismus geschaffen.
Wo keine Tradition war, wurde moniert, könne auch keine Kultur sein, ja nicht einmal ein Hauch von Anstand oder Sitte sei in Amerika zu finden. Von Honoré de Balzac bis zu Fanny Trollope beschrieben etliche Literaten die Vulgarität, die in den USA herrsche. Man kaue dort dauernd Tabak, spucke auf die Strasse und habe keinerlei Tischmanieren – alle der meist miserablen Gerichte würden aufs Mal aufgetragen und wortlos heruntergeschlungen.
Dieses niedere Verhalten brachten die konservativen Beobachter einerseits mit dem amerikanischen Staats- und Gesellschaftskonzept in Verbindung: Demokratie und Gleichheit hätten zur Folge, dass sich die rauen Sitten des einfachen Volkes durchsetzten. Andererseits führten sie die fehlende Kultur darauf zurück, dass die Amerikaner ihren Fokus ganz auf die Geschäfte richteten. In den USA, «diesem traurigen Land des Geldes», gefriere den Leuten die Seele, schrieb der Franzose Balzac. Weniger poetisch drückte es der Österreicher Nikolaus Lenau aus: «Diese Amerikaner sind himmelanstinkende Krämerseelen. Tot für alles geistige Leben, mausetot.»

Amerika, der Schädling: DDR-Broschüre zur Bekanntmachung angeblicher US-Angriffe, um 1950.

Gilles Barbier / Imagebroker / Keystone
Angst vor dem eigenen Abstieg
In genau diesem Punkt – in der Verachtung des «Geldmachens» – traf der konservative früh mit dem linken Antiamerikanismus zusammen. Die progressiven Kräfte konnten mit Amerika zwar insofern viel anfangen, als sie dessen politisches Projekt begrüssten: Demokratie und Freiheit von ständischen Fesseln wünschten sie sich auch in Europa. Auf wirtschaftlicher Ebene aber taugten die USA für die Linken nicht als Vorbild – wenigstens nicht für jene, die ab der Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Sozialismus sympathisierten.
Amerika, das war nicht nur Karl Marx, sondern allen Europäern klar, lebte Kapitalismus in Reinkultur. Und die seelenlose Herrschaft des Dollars, die daraus angeblich resultierte, prangerten linke Autoren genauso laut an wie konservative. Heinrich Heine etwa schrieb 1840 über die Amerikaner: «Der weltliche Nutzen ist ihre eigentliche Religion, und das Geld ist ihr Gott, ihr einziger, allmächtiger Gott.»
Mit Kulturlosigkeit und Geldgier waren bald die zwei wichtigsten antiamerikanischen Stereotype gefestigt. Sie dienten den Europäern nicht zuletzt dazu, sich abzugrenzen und eine eigene Identität zu behaupten. Entstanden waren diese Vorstellungen in einer Zeit, in der Amerika zwar schon für den Fortschritt stand, aber noch keineswegs als Weltmacht galt. Als Wirtschaft und Bevölkerung in den USA stark wuchsen, paarte sich der negative Blick auf das Land mit einer diffusen Angst: Die Amerikaner würden Europa mit ihrer Unkultur überrollen. So bemerkte Friedrich Nietzsche um 1880, dass das amerikanische Geschäftstreiben anfange, das alte Europa anzustecken und «eine ganz wunderliche Geistlosigkeit darüber zu breiten».
Solche Diagnosen wurden bezeichnenderweise meist von Vertretern der Elite gestellt. Für das Gros der Europäer waren die USA im 19. Jahrhundert weniger mit dem Schrecken des kulturellen Verlusts als mit der Hoffnung auf ein besseres Leben verbunden: Die Auswanderung nach Amerika bot vielen eine Chance, der Armut zu entkommen.
Diese Gegenläufigkeit ist wichtig, denn die Vertreter des Antiamerikanismus haderten stets auch mit der Tatsache, dass die USA, ihr «lifestyle» und ihre Produkte, vielen Leuten gefielen. Deutlich zeigte sich das in den 1920er Jahren. In Film, Musik oder Mode faszinierte alles Amerikanische die Menschen, und auch in der Wirtschaft orientierte sich die Avantgarde an den Vereinigten Staaten. Serienproduktion und Massenfertigung, symbolisiert durch Henry Fords Fliessband, wurden zum Synonym für Fortschritt. Doch in dem Mass, wie die USA Volk und Industrielle begeisterten, stiessen sie jene ab, die an Hergebrachtem festhalten wollten.
Männer schieben den Kinderwagen!
Der Baukasten der antiamerikanischen Argumente wurde damals zwar nicht wesentlich erweitert, aber die alten Stereotype wurden nun mit neuen Entwicklungen verbunden. Man sieht das etwa bei Adolf Halfeld, einem deutschen Journalisten. Sein Buch Amerika und der Amerikanismus (1927), ein Klassiker des amerikafeindlichen Denkens, zeigt schön, wie «Amerika» als Chiffre für jede beliebige Erscheinung diente, die einem in der Moderne nicht passte.
In bekannter Weise stellte Halfeld fest, dass die Amerikaner keinen Sinn für Tradition hätten. Folglich konnte es in den USA zu einer Umkehr der herkömmlichen Geschlechterordnung kommen: In Amerika, schrieb Halfeld entsetzt, schiebe der Mann den Kinderwagen, er decke den Tisch und trage das Geschirr in die Küche. Der Einfluss der Frau wiederum sei «unbegrenzt» – für den konservativen Beobachter ein grosser Schritt in Richtung Niedergang.
Wie frühere Autoren kritisierte Halfeld auch die «allumfassende Gleichförmigkeit», die in den USA herrsche. Statt aus der Demokratie leitete er sie aber aus der Wirtschaft ab: Der «Fordismus», schrieb er, drille «Millionen Menschen in eine Kasernenexistenz» und züchte Indifferenz. Die uniformen amerikanischen Menschenmassen sah er dann – der Zoologe Buffon lässt grüssen – mehr «dahinvegetieren» als wirklich leben. In diesen stumpfen Gestalten vermöchten letztlich nur noch die «barbarischen Nervenreize» der Jazzmusik irgendetwas auszulösen.
Auch die altbekannte amerikanische «Geldgier» führte der Autor mit einem seinerzeit aktuellen Thema zusammen. Seit der Jahrhundertwende sorgten sich viele um die Natur; man stellte fest, dass sich das moderne Leben negativ auf die Umwelt auswirkte. Laut Halfeld ging auch dieses Problem vom «Amerikanismus» aus. Die traditions- und wurzellosen Amerikaner hätten nämlich «kein Verhältnis zur Landschaft» und sähen Natur und Boden als reine Mittel zur Geldgewinnung. «Mine and Move» laute ihr Motto – ausbeuten und weiterziehen.

Alamy

akg
Das böse «Finanzkapital»
Als Menschen, die kein Heimatgefühl haben und nur ans Gewinnmachen denken, galten damals nicht allein die Amerikaner. Ganz ähnlich sprach man in völkisch-rechten wie in kapitalismusfeindlich-linken Kreisen auch von den Juden. In zahlreichen Texten des frühen 20. Jahrhunderts überlappten sich denn auch antiamerikanische und antisemitische Motive. Die Verbindung zwischen Amerikanern und Juden war umso leichter herzustellen, als man beiden in verschwörungstheoretischer Manier auch unterstellte, die Welt beherrschen zu wollen.
Bereits 1906 hielt ein Historisches Schlagwörterbuch fest, dass Juden und Amerikaner für dasselbe stünden: «Verjudung heisst eigentlich Amerikanisierung.» Unter den Nationalsozialisten setzte sich diese Ansicht in Deutschland restlos durch. In NS-Pamphleten wurden die USA als «grösste jüdische Kolonie der Gegenwart» bezeichnet. Von der jüdisch beherrschten Wall Street aus, hiess es, werde die Welt regiert. Oder mit einer Tiermetapher: «Wie der Krake der Tiefsee, so streckt dieses Land seine Arme nach allen Seiten. Hinter dem Kraken aber erscheint die Fratze des ewigen Juden.»
Im Kalten Krieg änderte sich etwas im Antiamerikanismus. Nicht, dass dem alten Denken neue Ideen zugefügt worden wären – gerade verschwörungstheoretisch grundierte Weltunterwerfungsszenarien blieben weiter in Mode. Aber die Amerikafeindschaft war jetzt eindeutig links verankert. Bis 1989 waren es die Kommunisten, die sich von Moskau über Pjongjang bis Ostberlin an den USA abarbeiteten. Zentral war dabei die Gleichsetzung mit dem «Bösen». Amerika, das sich vordergründig mit internationalen Institutionen wie der Uno für Frieden einsetze, plane in Wahrheit den dritten Weltkrieg, wussten die Kommunisten. Und auch allerlei anderen hinterhältigen US-Projekten kamen sie angeblich auf die Schliche. In der DDR etwa wurde behauptet, dass die Amerikaner Kartoffelkäfer über dem Land abwürfen, um Ernten zu vernichten und die Bevölkerung auszuhungern.
Hinter dem amerikanischen Bestreben, die Welt «imperialistisch zu versklaven», stand in kommunistischer Logik, wie bei den Nazis, «das amerikanische Finanzkapital». Auch linke Intellektuelle pflegten die Idee weiter, dass der Materialismus in den USA alles dominiere – und wie die Romantiker schlossen sie daraus, dass die Amerikaner wenig Geist besässen. Simone de Beauvoir bemerkte beispielsweise, dass das Individuum in den USA zu sehr mit technischen Utensilien wie dem Kühlschrank beschäftigt sei, «als dass es seinen Blick auf das Jenseits oder auf das Diesseits richten könnte».
Im Mainstream der Weltpolitik
Die Amerikaner als geistlose Bösewichte, die alles plattmachen wollen: In dieser Form nistete sich der Antiamerikanismus auch in der muslimischen Welt ein. In Iran behauptete der spätere Revolutionsführer Ayatollah Khomeiny ab den 1960er Jahren, die USA – der «grosse Satan» – zerstörten die traditionelle Kultur des Landes. Unterstützt würden die Schergen dabei von Israel, dem «kleinen Satan». Erneut trafen Antiamerikanismus und Antisemitismus zusammen.
Aus dem Lager der islamischen Fundamentalisten sollte schliesslich auch die grausamste Form des Antiamerikanismus kommen: Ihren Hass auf das Land der Moderne brachten sie am 11. September 2001 mit mörderischem Terror zum Ausdruck. Europa und andere Weltteile sind deswegen allerdings nicht amerikafreundlicher geworden. Vielmehr ging der Trend schon länger – und anhaltend – in die Gegenrichtung: Seit sich der Antiamerikanismus nach dem Ende der Sowjetunion aus seiner Bindung zum Kommunismus gelöst habe, sei er «tiefer denn je in den Hauptstrom der Weltpolitik eingeflossen», schrieb der Politologe Ivan Krastev 2004.
Ein Grund dafür dürfte in der intensivierten Globalisierung liegen. Die USA galten lange als Treiber dieser Entwicklung und wurden zum Feindbild linker und rechter Kritiker, die das kapitalistische Marktdenken verdammten oder den Verlust kultureller Eigenarten befürchteten.
Ein solcher Kulturverlust, meinen heute Amerikafeinde wie Wladimir Putin, könnte ans Lebendige gehen. Wenn alle ihre Traditionen aufgäben und den amerikanischen Unsitten folgten, hätte das nämlich verheerende Konsequenzen: «Gender-Ideologie», «Homosexuellen-Propaganda» und ähnliche «Perversionen», die von den USA ausgehend schon ganz Europa befielen, drohen laut Putin zur «Entartung» und zum «Aussterben» zu führen.
Zur Beruhigung möchte man dem Kreml einen Blick in die Geschichte empfehlen: Von der amerikanischen «Degeneration» war schon vor 250 Jahren die Rede. Doch anstatt langsam abzuserbeln, haben sich Amerika und die Amerikaner quicklebendig entwickelt. Der Antiamerikanismus dagegen ist seit den frühesten Tiraden im 18. Jahrhundert gedanklich kaum weitergekommen.
Ein Artikel aus der «»